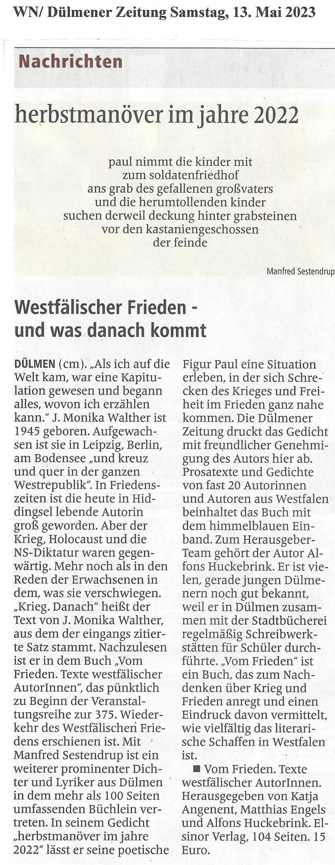Vom Krieg und vom Frieden
Der Dreißigjährige Krieg dauerte von 1618 bis 1648. In den Jahren vor diesem Krieg gab es drei große Konflikträume: West- und Nordwesteuropa, Oberitalien und den Ostseeraum. Überall wurde um Vorherrschaft und Unabhängigkeit gestritten. In Europa und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation hatte sich ein explosives Spannungsfeld aus politischen, dynastischen, konfessionellen und innenpolitischen Gegensätzen aufgebaut. Der Krieg begann als Religionskrieg und endete als Krieg um Grenzen, Besitz, Territorium, um nackte Macht in Europa. Eine ganze Reihe von weiteren Konflikten waren mit dem Dreißigjährigen Krieg eng verbunden und wurden ebenfalls bis aufs Blut ausgekämpft: da war der achtzigjährige Krieg zwischen den Niederlanden und Spanien von 1568 bis 1648; die Bündner Wirren zwischen den Koalitionen Frankreich-Venedig und Spanien-Österreich um den heutigen Kanton Graubünden; der Mantuanische Erbfolgekrieg zwischen Frankreich und Habsburg und der Französisch-Spanische Krieg, der bis 1659 dauerte.
 Die Friedenversuche während der dreißig Jahre misslangen, erst mit den Westfälischen Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück von 1641 bis 1648 konnte der Krieg beendet werden. Fünf Jahre dauerte der Friedenskongress aller Kriegsparteien, auf dem fast alle großen europäischen Mächte vertreten waren. Die Beschlüsse des Westfälischen Friedens und die Ergänzungen im Nürnberger Exekutionstag wurden als Reichsgrundgesetz behandelt und im vollen Wortlaut in den Beschluss des Reichstages vom 17. Mai 1654 aufgenommen, genannt Jüngster Reichsabschied. Der Westfälische Friede war Namensgeber des Westfälischen Systems und wurde zum Vorbild für spätere Friedenskonferenzen, da er dem Prinzip der Gleichberechtigung der Staaten, unabhängig von ihrer tatsächlichen Macht, zur Durchsetzung verhalf.
Die Friedenversuche während der dreißig Jahre misslangen, erst mit den Westfälischen Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück von 1641 bis 1648 konnte der Krieg beendet werden. Fünf Jahre dauerte der Friedenskongress aller Kriegsparteien, auf dem fast alle großen europäischen Mächte vertreten waren. Die Beschlüsse des Westfälischen Friedens und die Ergänzungen im Nürnberger Exekutionstag wurden als Reichsgrundgesetz behandelt und im vollen Wortlaut in den Beschluss des Reichstages vom 17. Mai 1654 aufgenommen, genannt Jüngster Reichsabschied. Der Westfälische Friede war Namensgeber des Westfälischen Systems und wurde zum Vorbild für spätere Friedenskonferenzen, da er dem Prinzip der Gleichberechtigung der Staaten, unabhängig von ihrer tatsächlichen Macht, zur Durchsetzung verhalf.
Am 24. Oktober 1648 endete der Krieg, dessen Feldzüge und Schlachten überwiegend auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches stattgefunden hatten. Die Kriegshandlungen und die durch sie verursachten Hungersnöte und Seuchen hatten ganze Landstriche verwüstet. In Teilen Süddeutschlands überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung. Nach den wirtschaftlichen und sozialen Verheerungen brauchten einige der vom Krieg betroffenen Gebiete mehr als ein Jahrhundert, um sich von den Folgen des Krieges zu erholen. Das Trauma blieb im kollektiven Gedächtnis der Menschen.
In diesem endlosen Krieg, der sich durch ganz Europa hin und her zog, wurden schwerste und barbarische Verbrechen begangen. Eines der Schlimmsten war die ‚Magdeburger Hochzeit‘, der erste Versuch eine ganze Stadt, ein ganzes Gebiet vllständig auszulöschen. Der Begriff „magdeburgisieren“ ist als Synonym für „völlig zerstören, auslöschen“ und als Sinnbild für „größtmöglichen Schrecken“ in die deutsche Sprache eingegangen. Die Menschen wurden systematisch ausgeplündert, umgebracht, die Stadt zerstört.
Die langen und komplizierten Friedensverhandlungen zeigen, dass selbst nach dem letzten Schuss, der letzten Bombe ein Krieg nicht vorbei ist. Die Menschen hungern, frieren, sind traumatisiert. Die Menschen waren Mörder, Totschläger, Opfer. Die Menschen schweigen, lügen. Beendete Kriege verwandeln sich in eingefrorene, kalte Kriege. Die Friedenszeit dient als Vorbereitung für den nächsten Krieg, während der vorherige noch in den Seelen und Körpern tobt. 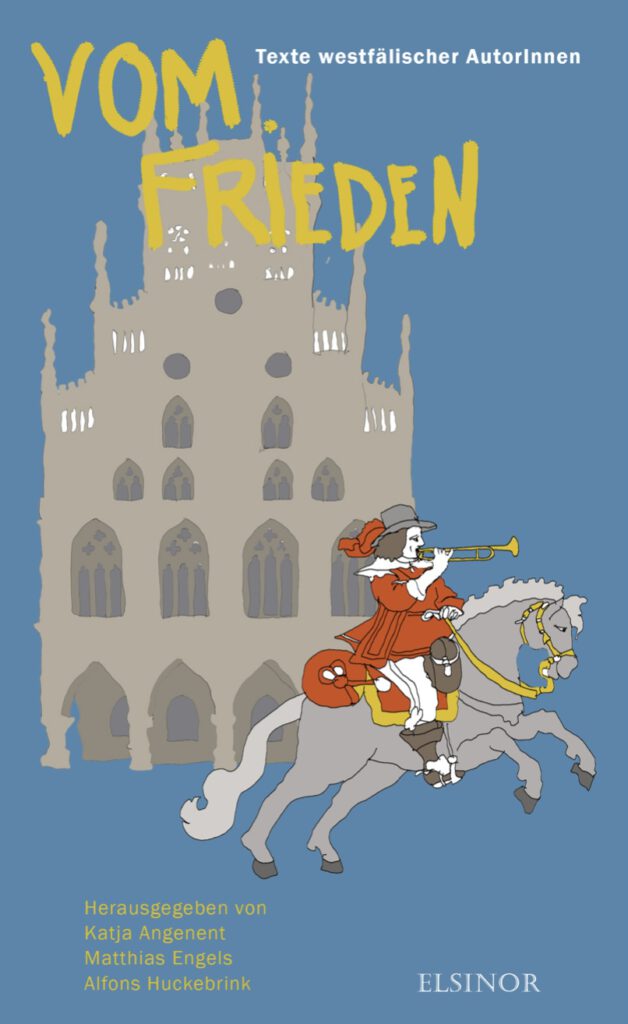
„Als wir Kriegskinder zwischen 1943 und 1948 auf die Welt kamen, zwischen die Trümmer und in die Kälte, den Hunger, waren die Erwachsenen sehr mit sich und dem, was sie angerichtet hatten beschäftigt. Sie schwiegen. Sie wussten genau, wer wie tief im braunen Dreck gewatet war. Wir Kinder liefen mit, hatten zu gehorchen, zu funktionieren. Still zu sein. Keine Fragen.
Als ich auf die Welt kam, war eine Kapitulation gewesen und begann alles, wovon ich erzählen kann. Die Zukunft war auf den Tag beschränkt. Auf die nächste aufgesparte Scheibe Brot, gebacken aus mehr Sägespane denn Mehl. Millimeterdünn geschnitten. In Kaffeesatz geröstet. Kartoffelschalen. Zu Brei verkocht. Graupen in Wasser.
Damals als die Welt voller Trümmer und Panzer war, als es nach Schwefel roch. Als es keine Farben gab. Damals als die Erwachsenen in den Trümmern ihres Lebens wühlten und schwiegen. Zwölf Jahre lang war nichts geschehen. Außer, dass so viele tot waren und das Land in Ruinen stand. Damals als wir Kinder keine Ahnung hatten, wonach diese Erwachsenen sich sehnten und was für Erinnerungen in ihren Köpfen geisterten. Wir Kinder verbrachten die Tage auf Schuttplätzen und Brachen, jagten Schmetterlinge, pflückten Hundeblumen und fochten mit Ästen gegen den Rest der Welt. Wir waren stundenlang selbstvergessen und in Spielen versunken. Taumelnd verloren, bis wir gerufen wurden und wir wieder vor diesen Erwachsenen mit ihren grauen Augen standen. Sie vermissten viel mehr als wir. Unzählige Dinge, eine andere Welt. Wir hatten keine Ahnung, was ihnen fehlte. Halt dich gerade, sitz gerade. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Was wussten sie schon vom Glück und vom Leben. Aber wir Kinder, wir begannen unser Leben zu erfinden. In unserer Fantasie waren wir voller Zukunft. Aber Tag für Tag verschwiegen wir unzählige Fragen.“
Krieg. Danach. ist der Titel meiner Erzählung in dem Buch ‚Vom Frieden‘. Für mich hörte der Krieg erst endgültig auf als ich über sechzig Jahre alt geworden war, als ich über die Familiengeschichte in den „Fluchtlinien“ (erscheinen im September 2023) geschrieben hatte und mit fast allen Lügen, dem Verschwiegenen, dem Falschen im Wahren und dem Wahren in den verkehrten Geschichten freundlich leben konnte. Ich wusste ja, wer ich war, was mich geprägt und was mich verbogen hatte. Der Krieg hört nicht mit dem letzten Schuss und einigen Unterschriften auf. Der Krieg geht noch lange weiter. Und ohne Krieg scheinen wir Menschen nicht leben zu wollen. Nicht im Kleinen, nicht im Großen. Immer wieder bauen wir einen Turm und reißen ihn ein und sei es, weil sich Menschen vor Veränderungen fürchten. So sehr, dass sie einen Krieg beginnen, der alles zerstört.