‚Das weiße Album‘
Joan Didion beginnt diesen Essay, den sie zwischen 1968 und 1978 schrieb, mit dem Satz: „Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben.“ Einen Absatz später später sagt sie: „Wenigstens machen wir das für eine Weile so.“ Der Text schließt mit den Wörtern: „Das Schreiben hat mir bisher nicht geholfen, den Sinn zu verstehen.“ Das weiße Album beschreibt ihren Zusammenbruch und den der amerikanischen Kultur. Der Legenden.
„Egal, wie pflichtbewusst wir niederschreiben, was wir um uns herum beobachten“, sagt sie in ihrem Text „Vom Sinn, ein Notizbuch zu besitzen“, „der gemeinsame Nenner ist immer, unverhüllt und schamlos, das unerbittliche Ich.“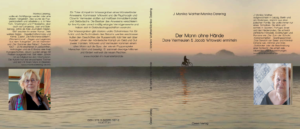
Meistens können wir ja ohnehin nicht unterscheiden zwischen Wirklichkeit und unserer eigenen Sicht auf Wirklichkeit, ab von der Schwierigkeit überhaupt zu erfahren, zu begreifen, was geschieht, wo die Wahrheit der Ereignisse stattfindet. „Wir interpretieren, was wir sehen. Wir leben von den ,Ideen‘, mit denen wir gelernt haben, die wechselnden Phantasmagorien einzufrieren, die unsere eigentliche Erfahrung sind.“ Für Joan Didion ist jede Einsicht eine subjektive, deshalb unterlässt sie es, ihre Ansichten als „objektive“ zu maskieren. Sie stellt sich selbst in den Mittelpunkt ihrer Texte, um das Perspektivische ihres Denkens, allen Denkens, sichtbar zu machen. Ein Versuch dem Erkennen-Wollen die Grausamkeit zu nehmen, aber die lässt sich nicht vermeiden.
Und: alles, was wir sehen, was wir erkennen wollen, ist von unserer Lebensgeschichte bestimmt. Wir sehen nicht die tote Mutter, sondern was wir mit ihr erlebt haben. Wir wollen die Wahrheit über einen Mord erfahren und versinken in Klischees und Stereotypen. Ein Totschlag wird untersucht, aber fragen wir, ob der Mörder weiß, was er tat, als er erst seine Großmutter um Geld anbettelte und dann zuschlug. Hinterher ein Bier trinken ging. Hundert Euro hatte er erbeutet und leistete keine Gegenwehr bei seiner Verhaftung. Wenn wir fragen, vergessen wir immer den Referenzrahmen (wer hat Recht und Gesetze geschaffen, wer stellt das richtenden Personal, wer schreibt, wer berichtet) und wir vergessen vor allen anderen Dingen eins: nicht die Fragen stellen Beweise dar, sondern allein die Antworten führen zu Beweisen. Wobei die Antworten nicht so einfach sein können, dass der Satz Alle Männer hassen Frauen – oder – die brutalsten Mörder töten zu ihrem eigenen Vergnügen in die Indizienkette als alleinige Beweisführung eingehen können. Und doch sind die Notizbücher mit solchen Hinweisen gefüllt (siehe die vielen Briefe, Fotografien, Berichte aus dem 3. Reich und sei es der Anblick der fröhlichen KZ-WächterInnen bei ihren Ausflügen. Wohlgenährt, vergnügt und ihrer Meinung nach im Recht und auf der richtigen Seite). Die weißen Alben des Lebens erzählen ab der Geburt an vom Tod und Töten. Von Hass, Gier und schwersten Verbrechen aller Art. Die Zivilisierung des Menschen scheint nur begrenzt (auch in der Zeit) möglich. Und so füllen sich die Blätter der Menschengeschichte mit großen Verbrechen. Mit Lug und Trug. Und mit vielen kleinen Morden und Tötungsversuchen: Aus Spaß und betrunken einen Obdachlosen anzünden. Durch Berlin rasen.
Die Diktatoren und Kriegsverbrecher landen im besten Fall vor den Gerichten in Den Haag. Die vielen Bürokraten und Beamten, die eifrig den großen Referenzrahmen für Verbrechen geschaffen haben, wechseln unauffällig ihr Mäntelchen, halten ein anderes Fähnchen hoch. Das nächste System bedient sich ihrer gerne. 
Die Menschenquäler foltern weiter in Lagern, Gefängnissen, führen vernichtende Kriege auf unterster Ebene, töten, rauben. Niemand bestraft oder bekämpft sie. Asymmetrische bewaffnete Auseinandersetzungen sind längst ein Wirtschaftsfaktor. Aber auch die vielen ‚Einzeltäter‘, die aus Lust, Gier oder im Namen einer Religion töten, die andere missbrauchen und mit den Bildern und Filmen dieser Schandtaten handeln, die im Namen irgendeiner Ideologie andere Menschen umbringen und bedrohen, sind nur schwer zu bändigen. Weder in Diktaturen noch in Demokratien. Und doch – Recht und Gesetz in liberalen Staatsformen sind der einzig mögliche Ausweg aus der mörderischen Anarchie.
So füllen sich die weißen Seiten des Albums, die Seiten des persönlichen Notizbuches, oft mit dem Versuch all diese Verbrechen zu rechtfertigen, zu objektivieren als etwas Notwendiges. Als wären sie die Ordnung und eine mögliche Lebensform, Überlebensform. Die alle Mafiosi immer wieder durchsetzen wollen.
Ja, manchmal erzählen wir einander Geschichten, voll der wahren Lügen, voller Entschuldigungen, voller gelogener Wahrheiten, aber auch voller Liebe und Entwürfe einer anderen Welt. Die professionellen Geschichtenschreiberinnen stehen in einer Verantwortung, sagt Bruno Bettelheim. Auf heute übertragen: Idealerweise ist Erzählen getragen vom Respekt vor den AdressatInnen. So, wie diese hoffen, unterstellen, dass die Autorinnen sich bewusst sind, warum sie ihre Geschichten erzählen, warum sie im Schreiben Welt entwerfen, Konflikte und Werte. Es kann nicht nur um die „stories“ gehen. Diejenigen, die erzählen, die schreiben können der Verantwortung nicht ausweichen.
 Die amerikanische Autorin Maggie Nelson schrieb die Autobiographie eines Prozesses: Die roten Stellen: 1969 wird eine Frau brutal ermordet. Dreißig Jahre später wird der Täter gefasst, und Maggie Nelson sitzt dem Mörder ihrer im Gerichtssaal gegenüber.
Die amerikanische Autorin Maggie Nelson schrieb die Autobiographie eines Prozesses: Die roten Stellen: 1969 wird eine Frau brutal ermordet. Dreißig Jahre später wird der Täter gefasst, und Maggie Nelson sitzt dem Mörder ihrer im Gerichtssaal gegenüber.
Seit einigen Jahren bemüht sich der Wiener Verlag Das vergessene Buch, das Werk der jüdischen Autorin Maria Lazar wieder zugänglich zu machen. Leben verboten ist todtraurig, komisch, ein Thriller zur Nazizeit.
Berlin 1931. Die Roaring Twenties sind vorbei. Massenarbeitslosigkeit, soziale Verelendung und politische Radikalisierung bestimmen den bürgerlichen Alltag. Nach dem großen Börsenkrach von 1929 steht auch der angesehene Bankier Ernst von Ufermann kurz vor dem Bankrott. Er muss nach Frankfurt, um einen neuen Kredit zu verhandeln. Am Flughafen werden ihm seine Papiere gestohlen. Das Flugzeug fliegt ohne ihn los. Als es kurz nach dem Start abstürzt, glaubt alle Welt, dass auch er unter den Opfern ist. Ufermann packt die Gelegenheit beim Schopf: Im Dienst eines jungen nationalsozialistischen Zirkels nimmt er eine neue Identität an, fährt nach Wien und taucht dort unter neuem Namen unter. Seine Ehefrau, die schon lange eine Affäre mit Ufermanns Kompagnon unterhält, streicht derweil die exorbitante Lebensversicherungssumme ihres Mannes ein.
Ein böses und verzweifeltes Katz- und Mausspiel um Täuschung, Verrat und Lüge beginnt, bei dem nur eines klar ist: Für Ernst von Ufermann bleibt das Leben verboten. Im Schatten des Hakenkreuzes ist die Welt der Kolportage plötzlich grausame Wirklichkeit geworden.
© J. Monika Walther